
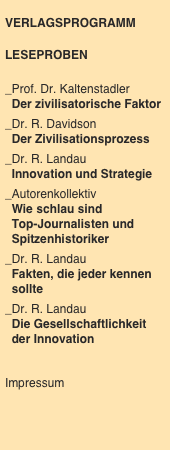
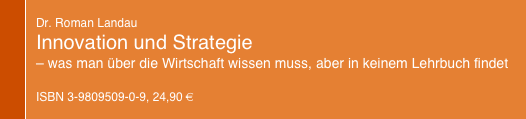
Leseprobe:
...
In Deutschland gibt es kein Standortproblem hinsichtlich Ideen. Eher besteht eine Lücke beim intelligenten Umgang mit Kreativität. Verkrustete Strukturen und eine .. Allianz vordergründiger Interessen verhindern den Durchbruch mancher Entwicklung. Das muss sich ändern.“ So überschrieb das HANDELSBLATT (6. 9. 2000, S.55) einen Artikel über die Innovationslücke in Deutschland.
Zwar gibt es jede Menge Risikokapital auch in Deutschland. Aber die Beteiligungsgesellschaften finden trotzdem keine interessanten Anlageobjekte. Und warum nicht? Bei den meisten Projekten, die angeboten werden, fehlt hinter der Technologie die überzeugende unternehmerische Persönlichkeit. Den Unternehmen wiederum, und hier insbesondere dem Mittelstand, fehlt meistens vollständig der Zugang zu den technologischen Ressourcen. Genau hier gibt es keine Kommunikations- oder Informationsstrukturen, die den Bedürfnissen der Unternehmer gerecht werden.“
Das Handelsblatt faßt die Problematik wie folgt zusammen. Drei entscheidende Elemente begründen die Dynamik unserer Wirtschaft: „Technologische Visionen und Kreativität, unternehmerische Durchsetzungskraft und drittens versierte Investoren.“ Es sei reiner Zufall, wenn diese drei Elemente zusammenfinden.
In den USA scheint das alles leichter zu sein. Dort werden immer wieder neue Unternehmen für die Durchsetzung neuer Ideen gegründet. Dort gibt es nämlich „Venture Money“, ein Begriff, der sich erst seit den neunziger Jahren durchgesetzt hat, obwohl es das, wofür er steht, nämlich Risikokapital, in den USA schon immer gegeben hat.
Der eigentliche Faktor X, der für das Wirtschaftswachstum und den Produktivitätsfortschritt verantwortlich ist, ist möglicherweise weniger die Innovation selbst, als vielmehr das Risikokapital, das aufgetrieben werden kann, um die Innovation auch wirklich an den Markt heranzuführen.
„Für die meisten Firmen ist das Leben unangenehm, brutal und kurz. Die Lebenserwartung einer typischen multinationalen Firma liegt zwischen 40 und 50 Jahren. Das bedeutet, daß ein Drittel aller Firmen aus der Liste der 500 größten amerikanischen Firmen bis zum Jahre 2010 pleite gegangen sein wird“, schrieb der Economist im Jahre 1997.
Für die kleineren Firmen sieht die Lage grundsätzlich noch ernster aus. Eine Studie der Stratix Consulting Group aus Amsterdam hat herausgefunden, daß die Lebenserwartung einer durchschnittlichen europäischen oder japanischen Firma weniger als 13 Jahre beträgt. (Economist, 10. May 1997, S. 69) Sind also Firmen in gewisser Weise wie Rockbands, die einige Jahre lang Erfolg haben, um dann sozusagen in der Versenkung zu verschwinden? Tatsächlich scheint auch das Geheimnis des Erfolgs ähnlich dem der Rockbands zu sein. Entscheidend ist, wer zuerst da war. (Wären die Rolling Stones so erfolgreich gewesen, wenn sie erst in den siebziger Jahren aufgetaucht wären?)
Eine Studie von Alfred Chandler (Harvard Business School) hat herausgefunden, daß die langfristig langlebigsten und erfolgreichsten Firmen die sind, welche in zwei Bereichen zuerst erfolgreich waren: nämlich Marketing und Vertrieb (distribution). Das bedeutet, daß nicht die Erfindung eines neuen Produktes das entscheidende war, sondern die Fähigkeit, ein neues Produkt mit Hilfe eines effizienten Vertriebssystems und mit Hilfe des Marketing in den Markt zu drücken. Und auf diese Weise die „economies of scale“ zu nutzen. Als Musterbeispiel wird Rockefellers Standard Oil (der Vorgänger von Exxon) angegeben. Standard Oil hat das Benzin nicht erfunden, aber erstmalig im großen Stil vertrieben und vermarktet.
Arie de Geus hat in seinem Buch „The Living Company“ darauf hingewiesen, daß es gerade nicht der starre Blick auf die Rendite ist, der die Lebenserwartung einer Firma verlängert. Nicht der share-holder value sollte oberste Maxime einer Firma sein, sondern ihre Kohäsion (cohesion): Das Zusammen-gehörigkeitsgefühl, d.h. die gemeinsame Identität der Mitarbeiter, die sog. corporate culture. Aber diese gemeinsame Identität, die McDonalds z.B. in eigenen Universitäten vermittelt, darf nicht zu einer dogmatischen Un-Kultur der Intoleranz gegenüber Exzentrikern werden, da es genau diese eigenwilligen „self driven individuals“ sind, von denen die innovativen Ideen produziert werden. Die Forscher von 3M z.B. bekommen 15% ihrer Arbeitszeit zur freien Verfügung, um ihre eigenen Ideen und Projekte zu verfolgen.
Die ZEIT überschrieb ihre Besprechung des De Geus Buches: „Gier macht vergänglich.“ Und Kira Börner faßt ihre Lektüre so zusammen: „Durch grundlegende Werte wie Stolz auf das Unternehmen oder Zugehörigkeit zur Firmenfamilie behalten sie ihre Identität auch im Wandel.“ Denn der Wandel ist das einzige Konstante, und überleben tun nur die, die sich dem Wandel anpassen. (ZEIT 48/1997)
1997 erschien ein anderes interessantes Buch: Patricia Pitcher, „Das Führungsdrama. Künstler, Handwerker und Technokraten im Management.“ Die Autorin kommt darin zu dem Ergebnis, daß es im Grunde nur zwei Typen von Managern gibt. Die Künstler und Handwerker auf der einen Seite und die Technokraten auf der anderen. Die wagemutigen und visionären Künstler bauen in Zusammenarbeit mit den verantwortungsbewußten Handwerkern die Unternehmen auf, die dann von den scheinbar brillianten Technokraten in den Niedergang getrieben werden. Technokraten sind geborene Selbstdarsteller und wirken auf Meetings ungemein beeindruckend mit ihren Schlagwörtern und Strategien. Vor allem aber beherrschen sie die Klaviatur der zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie verstehen es, sich geschickt ins rechte Licht zu setzen und Konkurrenten wirkungsvoll auszustechen. Zum Vorteil der eigenen Person und zum Nachteil der Firma.
In den neunziger Jahren gab es einige interessante Riesenpleiten in Deutschland. Balsam, Jürgen Schneider, Metallgesellschaft, Bremer Vulkan, und einige interessante Riesenverluste wie der bei Daimler-Benz und KHD. Anläßlich der Riesenverluste bei Klöckner-Humboldt-Deutz KHD fragte der SPIEGEL: „Wer paßt eigentlich auf“ und „Was ist los mit der deutschen Industrie. Arroganz und .. kriminelle Machenschaften haben ..weltweit für Schlagzeilen gesorgt.“ (23/1996, S. 96) Besonders gefährdet, Riesenverluste und Riesenpleiten zu erleben, sind nach einer Studie der Universität Mannheim übrigens genau die Unternehmen, die es eigentlich nicht sein sollten. Nämlich die, bei denen große Bankhäuser (involviert sind und) den Aufsichtsrat kontrollieren.